Übergeben Sie mir Ihr Konto, ich handle und profitiere für Sie.
MAM | PAMM | LAMM | POA
Forex-Prop-Firma | Vermögensverwaltung | Große Privatfonds.
Offizieller Start ab 500.000 US-Dollar, Test ab 50.000 US-Dollar.
Gewinne werden zur Hälfte (50 %) und Verluste zu einem Viertel (25 %) geteilt.
Foreign Exchange Multi-Account Manager Z-X-N
Akzeptiert den Betrieb, die Investitionen und die Transaktionen globaler Devisenkontoagenturen
Unterstützen Sie Family Offices bei der autonomen Vermögensverwaltung
Im Bereich des bidirektionalen Devisenhandels bieten MAM- (Multi-Account Management) und PAMM-Mechanismen (Percentage Allocation Management) zwar gewisse Sicherheitsvorteile, da sie die Risiken eines Schneeballsystems in der Fondsverwaltungsphase vermeiden, konnten sich aber aufgrund verschiedener Faktoren, darunter regulatorische Beschränkungen, Mängel in der technischen Architektur, Vertrauenskrisen am Markt, Ungleichgewichte in der Gewinnverteilung und der Einfluss neuer Handelsmodelle im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, nicht als gängiges Handelsmodell im Devisenmarkt etablieren. Ihre zentralen Schwachstellen lassen sich umfassend aus verschiedenen Perspektiven analysieren.
Erstens schränken die regulatorischen Beschränkungen den Handlungsspielraum der MAM/PAMM-Mechanismen erheblich ein. Weltweit haben die meisten Länder strenge regulatorische Vorgaben für die Qualifikation von Devisenhändlern und deren Geschäftsmodell erlassen, was die breite Anwendung von MAM/PAMM erheblich behindert. Beispielsweise verlangt die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) ausdrücklich, dass Unternehmen, die als MAM/PAMM-Manager tätig sind, über eine formelle Investmentmanagement-Lizenz verfügen und eine Kapitalreserve von mindestens 75.000 £ nachweisen müssen. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) schreibt vor, dass Händler die Qualifikation zum Commodity Trading Advisor (CTA) erwerben und Anlegern detaillierte Handelsstrategien, vergangene Performance-Daten und potenzielle Risiken offenlegen müssen. In der Praxis können viele kleine Handelsteams oder Einzelhändler diese strengen Qualifikations- und Kapitalanforderungen nicht erfüllen und bewegen sich daher in einer regulatorischen Grauzone. Aus diesem Grund zögern große, renommierte Forex-Broker, das MAM/PAMM-Modell in großem Umfang zu bewerben. Führende Forex-Broker wie Gain Capital versuchten beispielsweise, PAMM-bezogene Dienstleistungen einzuführen, mussten diese jedoch aufgrund stetig steigender regulatorischer Risiken und häufiger Kundenbeschwerden einstellen. Darüber hinaus haben einige Länder direkte Verbote erlassen, die es Einzelpersonen ohne entsprechende Qualifikation untersagen, Managed-Trading-Dienstleistungen anzubieten. Selbst wenn der MAM/PAMM-Mechanismus selbst keine Fondsverwaltung beinhaltet, unterliegt er dennoch strengen Auflagen der Aufsichtsbehörden, da er als „illegale Erbringung von Investmentmanagement-Dienstleistungen“ gilt.
Zweitens weist der technische Mechanismus systembedingte Mängel auf, die das Handelserlebnis und die Fondssicherheit erheblich beeinträchtigen. Die zugrunde liegende technische Architektur von MAM/PAMM hat zahlreiche unüberwindbare Schwächen. Die gravierendsten sind die Probleme der Copy-Trading-Kapazität und der Signallatenz. Traditionelle MAM/PAMM-Systeme unterstützen typischerweise nur etwa 100 MT4-Konten gleichzeitig für Copy-Trading, und die Übertragung von Handelssignalen ist stark von Servern Dritter abhängig. Es kommt zu erheblichen Verzögerungen bei der Signalübertragung vom Hauptkonto des Händlers zum Unterkonto des Anlegers. Diese Latenz führt leicht zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Kauf- und Verkaufspreisen im Unterkonto und im Hauptkonto. Dies resultiert in einer asymmetrischen Gewinnsituation, in der das Hauptkonto Gewinne erzielt, während das Unterkonto Verluste erleidet. Hinsichtlich der operativen Transparenz können Privatanleger im PAMM-Modell keine detaillierten Transaktionsaufzeichnungen in Echtzeit einsehen. Die Handelsentscheidungen und -aktionen der Betreiber sind intransparent. Selbst ohne das Risiko der Veruntreuung von Geldern können übermäßiger Handel und missbräuchliche Orderplatzierung die Interessen der Anleger schädigen. Da Anlegern vollständige Transaktionsdaten fehlen, fällt es ihnen oft schwer, ihre Rechte wirksam zu schützen. Im Hinblick auf die Kontokoordination werden bei PAMM-Konten die Gelder aller teilnehmenden Anleger proportional für den Handel zusammengeführt. Zieht ein Großanleger während einer laufenden Position Gelder ab, kann dies leicht zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Positionsverhältnis der verbleibenden Konten und damit zu kollektiven Verlusten führen. MAM-Konten hingegen nutzen ein unabhängiges Copy-Trading-Modell. Die Unterschiede in der Kontogröße zwischen den verschiedenen Unterkonten können jedoch leicht zu praktischen Problemen führen, beispielsweise dazu, dass kleinere Konten das Handelsvolumen des Hauptkontos nicht erreichen können, was den Copy-Trading-Effekt beeinträchtigt.
Darüber hinaus hält das langjährige Misstrauen gegenüber dem Markt die Anleger skeptisch gegenüber dem MAM/PAMM-Modell. Der Devisenmarkt selbst ist risikoreich, und das seit Langem bestehende Branchenchaos im MAM/PAMM-Bereich verstärkt das Misstrauen der Anleger zusätzlich. Was die Qualifikation und Performance von Händlern betrifft, ist Performancebetrug weit verbreitet. Einige Händler übertreiben ihre Fähigkeiten, indem sie historische Handelsaufzeichnungen fälschen und Daten zu maximalen Verlusten bewusst verschweigen, um Anleger anzulocken. Die bestehenden Mechanismen von MAM/PAMM können die Echtheit dieser Performancedaten nicht effektiv überprüfen. Selbst mit der Unterstützung einer seriösen Plattform lässt sich das chronische Problem der Branche, „mit kurzfristigen Gewinnen Gelder anzulocken und Anleger dann mit langfristigen Verlusten auszubeuten“, nur schwer beseitigen. Viele Händler verwenden verlockende Formulierungen wie „10 % monatliche Rendite“ und „garantierte Kapitalrückzahlung und Rendite“. Der Devisenmarkt ist jedoch von Natur aus sehr volatil, und solche Versprechen werden oft nicht eingehalten. Sobald erhebliche Verluste eintreten, kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Streitigkeiten zwischen Anlegern und Händlern bzw. Brokern. Aufsichtsbehörden entscheiden in der Regel, dass mündliche Gewinnversprechen dieser Art rechtlich nicht gültig sind und die Anleger die Verluste letztendlich selbst tragen müssen. Darüber hinaus haben zahlreiche nicht konforme Plattformen das MAM/PAMM-Modell in der Vergangenheit für irreführende Werbung und sogar verschleierte Kapitalbeschaffungsaktivitäten missbraucht, was bei Anlegern den Eindruck erweckt hat, dieses Modell sei „betrügerisch“. Selbst seriöse MAM/PAMM-Unternehmen haben Schwierigkeiten, diese negative Wahrnehmung zu korrigieren und das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen.
Gleichzeitig mindert das Ungleichgewicht zwischen Gewinnverteilung und Risikotragung die Attraktivität des MAM/PAMM-Modells für Anleger zusätzlich. Die Gewinnverteilungsstruktur dieses Mechanismus ist für Anleger grundsätzlich ungünstig. Im Hinblick auf die Gewinnbeteiligung erhalten Händler typischerweise 20–30 % der Gewinne als Managementgebühren, während Verluste vollständig vom Anleger getragen werden. Dieses Modell der „Gewinnbeteiligung mit Verlusttragung“ verleitet Händler zu risikoreichen Transaktionen, um höhere Provisionen zu erzielen. Dies führt zu einem erheblichen Missverhältnis zwischen dem Risiko für die Anleger und den potenziellen Renditen. Im Hinblick auf die Liquidität sehen einige MAM/PAMM-Produkte mehrmonatige Sperrfristen vor. Während dieser Zeiträume können Anleger keine Gelder abheben und selbst bei schlechter Performance des Traders potenzielle Verluste nur passiv tragen. Dies widerspricht dem zentralen Bedürfnis der Anleger nach flexibler Kapitalverwendung und schwächt die Marktakzeptanz dieses Modells erheblich.
Darüber hinaus hat der Einfluss neuer alternativer Modelle im KI-Zeitalter den Markt für MAM/PAMM weiter verkleinert. Durch den verstärkten Einsatz von KI-Technologie im Devisenhandel ersetzen neue Modelle wie intelligente Handelssysteme und Expert Advisors (EAs) zunehmend die Kernfunktionen von MAM/PAMM. KI-Handelssysteme ermöglichen vollautomatisierten Handel durch ausgereifte Algorithmen und machen menschliches Eingreifen überflüssig. Sie können Handelsstrategien in Echtzeit testen und das Risiko präzise steuern, wodurch das mit menschlichem Handel verbundene Moral Hazard vermieden wird. Neue Modelle wie Social Trading und Copy Trading ermöglichen es Anlegern, Trader auszuwählen, denen sie folgen möchten, und deren Verhalten in Echtzeit zu überwachen. Dies bietet deutlich mehr Flexibilität und Transparenz als das traditionelle MAM/PAMM-Modell.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MAM/PAMM-Mechanismus zwar gewisse Vorteile hinsichtlich der Fondssicherheit bietet, da er die Fondsverwaltungsphase umgeht, seine inhärenten Schwächen in der technischen Architektur, strenge regulatorische Vorgaben, das seit Langem bestehende mangelnde Marktvertrauen, gravierende Ungleichgewichte in der Gewinnverteilung und der Einfluss neuer Modelle im KI-Zeitalter ihn jedoch daran hindern, sich an die allgemeine Entwicklung des Devisenmarktes anzupassen. Selbst im Zeitalter der rasanten KI-Entwicklung wird es schwierig sein, diese zentralen Hindernisse zu überwinden und eine breite Marktakzeptanz zu erreichen.
Im bidirektionalen Handelssystem des Devisenhandels sind Forex-Broker, die in Hongkong ordnungsgemäß registriert sind, bei der Wahl ihres Handelsmodells nicht auf ein einzelnes Wett- oder Verkaufsmodell beschränkt.
Stattdessen können sie je nach ihrer Geschäftsstruktur, ihrer spezifischen Kundschaft und den regulatorischen Anforderungen der Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) flexibel zwischen Market-Maker-Modellen (Wettmodell), STP/ECN-Modellen (Verkaufsmodell) oder einem Hybridmodell wählen. Unabhängig vom gewählten Modell müssen sie die Compliance-Vorschriften und regulatorischen Anforderungen der Hong Kong SFC strikt einhalten.
Die Hong Kong SFC hat das Wettmodell für Broker mit einer Forex-Handelslizenz des Typs 3 mit Hebelwirkung nicht ausdrücklich verboten. Die zentrale regulatorische Anforderung besteht darin, Transparenz im Handelsmodell zu gewährleisten und einen soliden Risikomanagementmechanismus zu etablieren. Im Rahmen des Market-Maker-Modells (DD/MM, auch bekannt als Kontrahentenhandelsmodell) erlaubt die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) Brokern, als direkte Kontrahenten für die Transaktionen ihrer Kunden aufzutreten. Dies beinhaltet die Annahme von Kundenaufträgen und deren interne Absicherung, ohne diese Aufträge an den externen Markt weiterzuleiten. Allerdings müssen Broker dieses Handelsmodell in ihren Geschäftsplänen klar und vollständig offenlegen, ein Managementsystem einrichten, das Preisgestaltung und Risikokontrolle trennt, grundlegende regulatorische Anforderungen wie die vollständige Transaktionsdokumentation erfüllen und die Manipulation von Kursen oder vorsätzliches Slippage zum Nachteil der legitimen Handelsrechte ihrer Kunden strikt untersagen. Dieses Handelsmodell eignet sich typischerweise für Privatkunden mit geringem bis mittlerem Kapital, und die Haupteinnahmequelle der Broker ist häufig der Spread. Im STP/ECN-Modell (Short-Term Transfer/Electronic Communication Network) können lizenzierte Broker STP oder ECN nutzen, um Kundenaufträge direkt an den Interbankenmarkt, professionelle Liquiditätsanbieter (wie große internationale Finanzinstitute wie Goldman Sachs und Morgan Stanley) oder andere konforme Kontrahenten weiterzuleiten. Die Broker selbst fungieren lediglich als Vermittler und erzielen ihren Gewinn aus Transaktionsgebühren oder Spreads. Sie unterhalten keine direkte Wettbeziehung zu ihren Kunden. Dieses Modell wird aufgrund seiner hohen Fairness und Transparenz häufiger von professionellen Anlegern oder zur Abwicklung großer Transaktionsaufträge genutzt. Darüber hinaus wählen die meisten konformen Forex-Broker in Hongkong ein Hybridmodell (DD+NDD). Das bedeutet, dass kleine Handelsaufträge, Hochfrequenzhandelsaufträge oder Aufträge von Kunden mit Verlusten intern durch Hedging abgewickelt werden, während große Handelsaufträge und Aufträge von profitablen Kunden an den externen Handelsmarkt weitergeleitet werden. Für Broker, die dieses Hybridmodell nutzen, schreibt die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) ausdrücklich vor, klare Standards für die Auftragsklassifizierung und -verarbeitung festzulegen, die spezifischen Verarbeitungsmethoden für verschiedene Auftragsarten eindeutig zu unterscheiden und die Richtlinien zum Umgang mit Interessenkonflikten gegenüber den Kunden vollständig offenzulegen.
Die Wahl des Handelsmodells eines Brokers hängt von einer Kombination zentraler Faktoren ab. Hinsichtlich Kundentyp und Handelsvolumen unterliegen kleine Handelsaufträge von Privatkunden (typischerweise unter 10.000 US-Dollar) häufig der objektiven Beschränkung des Mindesthandelsvolumens im Interbankenmarkt und fallen oft in den internen Hedging-Bereich des Brokers. Aufträge von institutionellen Kunden oder große Handelsaufträge (in der Regel über 100.000 US-Dollar) werden hingegen eher zur Ausführung an den externen Handelsmarkt weitergeleitet. Aus regulatorischer Sicht schreibt die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) vor, dass Broker unabhängig vom verwendeten Handelsmodell grundlegende regulatorische Anforderungen erfüllen müssen, wie z. B. die getrennte Verwahrung von Kundengeldern, regelmäßige Prüfungen der Handelsaufzeichnungen und die vollständige Offenlegung der Handelsrisiken. Auch bei einem Kontrahentenmodell müssen potenzielle Interessenkonflikte zwischen Kundengewinnen und -verlusten und den eigenen betrieblichen Interessen des Brokers angemessen und effektiv gemanagt werden. Broker, die sich auf institutionelle Kunden konzentrieren, wählen in Anbetracht ihrer Geschäftsausrichtung tendenziell das STP/ECN-Modell, um Professionalität und Fairness im Handel zu gewährleisten. Broker, die sich primär an Privatkunden richten, kombinieren dieses Modell hingegen häufig mit einem Market-Maker-Modell, um die Effizienz der täglichen Transaktionsverarbeitung zu verbessern und den Handelsbedürfnissen von Privatkunden besser gerecht zu werden.
Es ist wichtig zu verdeutlichen, dass sich das von konformen Hongkonger Brokern verwendete Kontrahentenmodell grundlegend von Offshore-Kontrahentenplattformen ohne regulatorische Zulassung unterscheidet. Erstere unterliegen dem strengen Regulierungsrahmen der Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) und erfordern neben einem Stammkapital von 30 Millionen HK$ und der Implementierung eines getrennten Systems für Kundengelder und Eigengelder auch regelmäßige Compliance-Prüfungen und Geschäftsaudits durch die Aufsichtsbehörden. Letztere greifen hingegen häufig auf böswillige Manipulation von Handelsdaten und unangemessene Auszahlungsbeschränkungen zurück, um unrechtmäßige Gewinne zu erzielen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine unregulierte, illegale Glücksspielplattform, die keinerlei Schutz für die Gelder und Rechte der Kunden bietet.
Im Bereich des Devisenhandels unterliegen Forex-Broker, die in Japan ordnungsgemäß registriert sind, strengen Auflagen der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) hinsichtlich ihrer Handelsmodelle. Insbesondere das Kontrahentenhandelsmodell unterliegt strengen regulatorischen Beschränkungen.
Das gängigste Handelsmodell in der Branche ist STP/ECN (d. h. Sell-Side-Trading). Interne Hedging-Geschäfte sind nur in wenigen spezifischen Geschäftsszenarien zulässig und müssen extrem hohen Transparenzanforderungen und strengen Compliance-Standards der Aufsichtsbehörden genügen. Dies unterscheidet die Handelsmodelle konformer japanischer Broker grundlegend von unregulierten, illegalen Kontrahentenhandelsplattformen.
Die japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) hat klare und strenge regulatorische Regeln für Forex-Broker mit Lizenzen für den Handel mit erstklassigen Finanzinstrumenten festgelegt. Die zentrale regulatorische Vorgabe besteht darin, betrügerische Wettaktivitäten, die von Kundenverlusten profitieren, zu unterbinden und Broker zu verpflichten, Kundenaufträge vorrangig marktbasiert abzuwickeln. Dies bedeutet, dass die Weiterleitung an den Interbankenmarkt oder an konforme Liquiditätsanbieter priorisiert werden muss. Bezüglich der marktbasierten Anforderungen an die Auftragsausführung schreibt die FSA ausdrücklich vor, dass Broker den genauen Ausführungsweg gegenüber Markt und Kunden vollständig offenlegen müssen. In der Phase des Liquiditätszugangs müssen sie sich mit mindestens zwei erstklassigen inländischen Liquiditätsanbietern verbinden, darunter Finanzinstitute mit starker Kapitalausstattung und etablierten Preissystemen wie die Mitsubishi UFJ Bank und die Mizuho Bank, um sicherzustellen, dass Kunden echte und faire Marktkurse erhalten. Auf dem japanischen Devisenmarkt haben führende Broker wie Rakuten Securities und SBI-FXTRADE das ECN-Handelsmodell vollständig eingeführt und verbinden Kundenaufträge direkt mit dem Interbankenmarkt. Dadurch werden direkte Kontrahentenbeziehungen zu Kunden vermieden und Interessenkonflikte durch Wetten grundsätzlich verhindert. Bezüglich der internen Hedging-Vorschriften müssen Broker, die vorübergehend internen Hedging-Bedarf für kleine Aufträge (z. B. Retail-Aufträge unter 1000 Lots) haben, Kerndaten wie das spezifische Hedging-Verhältnis und detaillierte Informationen zum Kontrahenten in einem speziellen Transaktionsbericht, der monatlich an die japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) übermittelt wird, genau offenlegen. Sie unterliegen zudem dynamischen Echtzeit-Audits durch Aufsichtsbehörden und dürfen sich nicht unrechtmäßig an den Handelsverlusten ihrer Kunden bereichern, beispielsweise durch Manipulation von Slippage oder Verzögerung der Auftragsausführung.
Die Handelsmodelle konformer Forex-Broker in Japan weisen insgesamt eine hohe Einheitlichkeit auf, die alle auf dem Grundprinzip der marktorientierten Auftragsausführung basieren. Im Wesentlichen lassen sie sich in zwei Haupttypen unterteilen. Das ECN/STP-Modell ist dabei die am weitesten verbreitete Wahl in der Branche. Führende Handelsplattformen wie SBI-FXTRADE, Rakuten Securities, DMM-FX und Okasan-Online verfügen über ausgereifte ECN- (Electronic Communication Network) oder STP-Architekturen (Straight Through Processing), die Kundenaufträge direkt an den Interbankenmarkt oder professionelle Liquiditätspools weiterleiten. Ihre Gewinnquellen beschränken sich auf Handelsgebühren oder angemessene Spreads; sie profitieren nicht von Kundenverlusten durch Wetten gegen deren Verluste. SBI-FXTRADE beispielsweise ist nicht nur mit führenden japanischen Liquiditätsinstitutionen wie der Mitsubishi UFJ Bank verbunden, sondern auch mit den Liquiditätskanälen großer internationaler Finanzinstitute wie JPMorgan Chase und Citibank. Dadurch wird eine faire und effiziente Auftragsausführung gewährleistet. Eine weitere Möglichkeit ist das begrenzte interne Hedging in Nischenszenarien. Einige Broker führen temporäres internes Hedging für Mikroaufträge von Privatkunden durch (z. B. Aufträge mit einem Volumen von weniger als einem Lot). Diese Transaktionen unterliegen jedoch strikt den von der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde festgelegten Hedging-Ratio-Grenzwerten. Üblicherweise darf das Volumen intern abgesicherter Aufträge 10 % des Gesamtauftragsvolumens der Plattform nicht überschreiten, und der Absicherungsmechanismus muss den Kunden bei der Kontoeröffnung transparent offengelegt werden. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Art der internen Absicherung kein „Wetten“ im herkömmlichen Sinne darstellt. Ihr Hauptzweck ist die Reduzierung der Transaktionskosten von Kleinaufträgen, und die aus der Absicherungsoperation resultierende Nettoposition muss umgehend am externen Handelsmarkt zur marktbasierten Abwicklung verkauft werden.
Im Vergleich zu den Regulierungssystemen für den Devisenhandel in anderen Regionen weisen die japanischen Regulierungsbestimmungen strengere Merkmale auf. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den japanischen und den Hongkonger Vorschriften zeigen sich hauptsächlich in drei Aspekten. Hinsichtlich der Beschränkungen der Gewinnquellen verbietet die japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) Brokern ausdrücklich, die Handelsverluste ihrer Kunden in ihre Einnahmen einzubeziehen und unterbindet damit die Gewinnkette des Wettmodells an der Quelle. Im Gegensatz dazu verlangt die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) von Brokern lediglich die vollständige Offenlegung ihrer Handelsmodelle, ohne strenge Beschränkungen für deren Gewinnquellen aufzuerlegen. Hinsichtlich der Liquiditätszugangsanforderungen müssen japanische Broker auf Liquiditätskanäle führender lokaler Banken wie der Mitsubishi UFJ Financial Group zugreifen, um die Eignung ihrer Kurse für den japanischen Markt zu gewährleisten. Hongkonger Broker hingegen können je nach Bedarf flexibel Offshore-Liquiditätsanbieter wählen. In Bezug auf Hebelwirkung und Risikomanagement ist in Japan die Hebelwirkung im Devisenhandel auf das 25-Fache begrenzt. Dies schränkt den Spielraum von Brokern weiter ein, Kunden durch hohe Hebelwirkung zu übermäßigem Handel zu verleiten und anschließend von deren Verlusten zu profitieren. In Hongkong liegt die Hebelwirkungsgrenze für den Devisenhandel bei bis zu 200. Der Fokus des Risikomanagements liegt dort stärker auf der Offenlegung von Handelsmodellen und der Einrichtung von Risikokontrollmechanismen.
Lizenzierte Forex-Plattformen in Hongkong verwenden Hongkong-Dollar und US-Dollar nicht als alleinige Margin-Anforderungen; diese werden lediglich als Kernposition genutzt. Andere Währungen können nur mit einem Abschlag als Sicherheiten hinterlegt werden. Diese Praxis ist keine strikte, gesetzlich verbotene Regel, sondern eine praktische Entscheidung, die sich aus den Erwägungen von Compliance, Clearing und Risikomanagement ergibt.
Die SFC schreibt vor, dass Kundengelder in ihrer jeweiligen Originalwährung getrennt geführt werden müssen. Da über 90 % der weltweiten Forex-Transaktionen in US-Dollar abgewickelt werden, müssten Broker, wenn australische Dollar, Euro und Schweizer Franken in die direkten Margin-Anforderungen einbezogen würden, für jede Währung separate Treuhandkonten bei lizenzierten Banken in Hongkong eröffnen, diese täglich zum US-Dollar neu bewerten und Reserven für selbst geringfügige Wechselkursschwankungen vorhalten. Dies ist umständlich und kapitalintensiv. Daher akzeptieren die meisten Plattformen ausschließlich Hongkong-Dollar und US-Dollar und tauschen alle anderen Währungen mit einem Abschlag von 0,9 oder sogar 0,85 in US-Dollar um. So werden die Trennungsanforderungen erfüllt und gleichzeitig Wechselkursdifferenzen minimiert.
Das lokale Clearing-System Hongkongs hat seine Dual-Currency-Basis ebenfalls gestärkt. Broker greifen auf Interbanken-Liquiditätspools in US-Dollar zu, wobei Hongkong-Dollar ausschließlich für Ein- und Auszahlungen von Privatkunden verwendet werden. Die Einführung von japanischen Yen und kanadischen Dollar würde separate grenzüberschreitende Kanäle erfordern, und kleine Währungsbeträge müssten über mehrere Zwischenhändlerbanken abgewickelt werden. Spreads und Bearbeitungszeiten würden an den Kunden weitergegeben, was das Handelserlebnis beeinträchtigen würde. Darüber hinaus legt die SFC (Securities and Futures Commission) für jede Währung separate Risikoreserven fest; die Hinzunahme einer weiteren Währung erhöht das Risiko und verkompliziert die Berechnung der Eigenkapitalquote erheblich. Plattformen beschränken ihre Kanäle auf Hongkong-Dollar und US-Dollar, wodurch die Risikogewichtung am einfachsten zu berechnen und die Finanzberichte am übersichtlichsten sind.
Europäische und amerikanische Plattformen können US-Dollar, Euro, Britische Pfund, Japanische Yen, Schweizer Franken und Kanadische Dollar in ihre Direktmargin-Konten einbeziehen, da sie über umfassende Absicherungsinstrumente verfügen. Obwohl sowohl die FCA als auch die ESMA eine Trennung der Währungen vorschreiben, erlaubt die FCA Brokern die Verwendung von Overnight-FX-Swaps, Währungs-Forwards und Cross-Currency-Basis-Swaps, um Positionen in mehreren Währungen innerhalb von Millisekunden auszugleichen. Die Interbankenpools in London und New York können diese Währungen in Echtzeit abwickeln. Die Plattform muss lediglich ein einziges integriertes Konto beim Clearinghaus führen; das System wandelt die GBP-Margin des Kunden automatisch in ein entsprechendes USD-Exposure um – zu Kosten von weniger als 0,2 Basispunkten, wodurch die zusätzlichen Gebühren praktisch nicht wahrnehmbar sind. Institutionelle Kunden verfügen bereits über Multi-Currency-Funding-Pools, sodass die Plattform „währungsneutrale“ Konten anbieten kann. Kunden können mit Schweizer Franken Kontrakte über 1 Million US-Dollar eröffnen, inklusive automatischer Swap-Absicherung im Backend. In den Berichten ist keine Wechselkursdifferenz ersichtlich, und die Aufsichtsbehörden billigen dieses Modell, bei dem das Nettorisiko nach der Absicherung null beträgt.
Hongkonger Plattformen fehlt es nicht an der Technologie, sondern an Skaleneffekten. Das lokale Handelsvolumen von Privatkunden ist relativ breit gestreut. Würden sie Swap-Linien der Bank von Japan in Tokio für eine Marge von wenigen Tausendstel Yen abschließen, würden sich die Fixkosten nicht amortisieren. Es ist effizienter, wenn Kunden ihre Yen verkaufen und in US-Dollar tauschen, wobei die Plattform lediglich die Wechselkursdifferenz einnimmt. Das Ergebnis mag oberflächlich betrachtet wie eine „Dominanz des Hongkong-Dollars gegenüber dem US-Dollar“ erscheinen, ist aber in Wirklichkeit eine rationale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen: Zwei getrennte Konten, ein US-Dollar-Clearingkanal und ein Hongkong-Dollar-Reservefonds genügen, um die Anforderungen der SFC, der Banken und der Wirtschaftsprüfer gleichzeitig zu erfüllen, was Kapital spart und den Aufwand für die Einhaltung von Vorschriften reduziert.
Im Devisenhandel unterstützen Forex-Broker in Europa und den USA in der Regel alle wichtigen Währungen wie Euro, Britisches Pfund und Japanischer Yen als direkte Margin für den Handel. Die Hauptvorteile dieses Geschäftsmodells liegen nicht nur in der Senkung der Gesamtkosten für Händler, der Verbesserung der Kapitaleffizienz und der Anpassung an unterschiedliche Handelsbedürfnisse, sondern auch in den Vorteilen für die Broker selbst, wie der Erweiterung ihres Kundenstamms und der Optimierung ihrer Risikostruktur. Dieser einzigartige Vorteil ist eine zwangsläufige Folge des Zusammenspiels eines lockeren und flexiblen regulatorischen Umfelds und eines hochentwickelten Finanzmarktsystems in diesen Regionen.
Aus Sicht der Hauptvorteile für Händler liegt der Wert des Multi-Währungs-Margin-Modells vor allem in seiner Fähigkeit, die expliziten und impliziten Kosten der Währungsumrechnung deutlich zu reduzieren. Für Händler, deren Kapital in anderen Währungen als dem US-Dollar gehalten wird, wie beispielsweise Euro und Britisches Pfund, kann die direkte Verwendung der entsprechenden Währung als Margin die Transaktionsgebühren und Wechselkursverluste, die durch den Währungsumtausch entstehen, vollständig vermeiden. Nehmen wir als Beispiel Händler aus der Eurozone, die mit dem Währungspaar EUR/USD handeln: Sie können die Margin direkt in Euro hinterlegen, ohne diese vorher in USD umtauschen zu müssen. Dadurch sparen sie die üblicherweise von Banken oder Zahlungsdienstleistern erhobenen Umtauschgebühren von 0,5 % bis 1,5 % und vermeiden versteckte Verluste durch Wechselkursschwankungen in Echtzeit während des Umtauschprozesses. Im Gegensatz dazu erhöhen die Regeln von Brokern in Hongkong, die den Umtausch von Währungen, die nicht USD oder HKD entsprechen, mit einem Abschlag vorschreiben, diese Kosten für Händler zusätzlich und reduzieren so das tatsächlich für den Handel verfügbare Kapital. Zweitens verbessert dieses Modell die Effizienz und Flexibilität der Kapitalnutzung erheblich. Das Multi-Währungs-Margin-System ermöglicht es Händlern, Kapital flexibel auf verschiedene Währungen innerhalb ihrer Konten entsprechend unterschiedlicher Handelsstrategien für Währungspaare zu verteilen, ohne das gesamte Kapital in USD oder HKD umtauschen zu müssen. Beispielsweise können Anleger, die sich auf Yen-Währungspaare (wie GBP/JPY, EUR/JPY) konzentrieren, Yen direkt als Margin verwenden. Die Marginberechnung bei Positionseröffnung ist besser auf die Währungsmerkmale des Handelsinstruments abgestimmt. Dadurch werden ungenutzte Mittel aufgrund von Währungsumrechnungen vermieden und das Risiko einer Margin-Entwertung durch Wechselkursschwankungen effektiv reduziert. Dies gewährleistet die stabile Umsetzung von Handelsstrategien. Darüber hinaus ist das Multi-Währungs-Marginmodell optimal an lokale Kapitalstrukturen und Handelsgewohnheiten anpassbar. Händler in verschiedenen Regionen Europas und Amerikas können ihre jeweiligen Fiatwährungen direkt als Margin nutzen und so ihre tägliche Geldmanagementlogik umsetzen. Beispielsweise können britische Händler mit Pfund Sterling am GBP/USD-Handel teilnehmen und australische Händler mit australischen Dollar am AUD/USD-Handel. Dadurch entfällt die Notwendigkeit häufiger und umständlicher Währungsumrechnungen. Dies beschleunigt Ein- und Auszahlungen erheblich und verhindert verpasste Handelschancen aufgrund von Verzögerungen beim Währungsumtausch. Das Handelserlebnis wird somit weiter optimiert.
Auch für Broker selbst bietet das Multi-Währungs-Margin-Modell erhebliche Vorteile. Erstens erweitert es effektiv den globalen Kundenstamm. Da alle wichtigen Währungen als Margin unterstützt werden, erfüllt es die individuellen Finanzierungsbedürfnisse von Kunden in verschiedenen Ländern und Regionen und hilft Brokern, Trader aus der Eurozone, Großbritannien, Kanada, Australien und anderen Teilen der Welt zu gewinnen. Im Vergleich zu Hongkonger Brokern, die nur USD/HKD unterstützen, bietet es eine größere Kundenreichweite. Große Forex-Broker, die über zehn wichtige Währungen als Margin anbieten, haben Kunden auf den wichtigsten globalen Finanzmärkten und erzielen dadurch einen deutlichen Skalenvorteil. Zweitens optimiert dieses Modell die Effizienz des gesamten Risikomanagements. Europäische und amerikanische Broker können das Multi-Währungs-Margin-System nutzen, um die Handelspositionen ihrer Kunden in verschiedenen Währungen präzise mit den entsprechenden Liquiditätsanbietern abzusichern und so das mit dem USD verbundene konzentrierte Risiko zu reduzieren. Beispielsweise können Broker bei Euro-Margin-Positionen direkt auf Interbanken-Liquiditätspools in der Eurozone zugreifen, was zu einer zeitnahen und präzisen Absicherung führt. Darüber hinaus können professionelle Instrumente wie Forex-Forwards und Währungsswaps die mit mehreren Währungen verbundenen Wechselkursrisiken effizient managen. Dies ist ein wesentlicher Grund für die Genehmigung des Multi-Währungs-Margin-Modells durch die lokalen Regulierungsbehörden. Drittens stärkt dieses Modell die Wettbewerbsfähigkeit im Kernmarkt erheblich. In den hochentwickelten und wettbewerbsintensiven Devisenmärkten Europas und der USA hat sich die Unterstützung von Multi-Währungs-Margin zu einem der wichtigsten Wettbewerbsvorteile für Broker entwickelt. Führende Broker konnten durch flexible Währungsoptionen erfolgreich professionelle institutionelle Anleger und Hochfrequenzhändler gewinnen. Diese Kunden stellen extrem hohe Anforderungen an Transaktionskosten und Kapitaleffizienz, und das Multi-Währungs-Margin-System kann ihren anspruchsvollen Handelsbedürfnissen besser gerecht werden und Brokern so einen differenzierten Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Im Vergleich zu Hongkonger Forex-Brokern führen die unterschiedlichen Regeln für Margin-Währungen zu verschiedenen geschäftlichen Unterschieden. Hinsichtlich der Händlerkosten fallen beim Multi-Währungs-Margin-Modell europäischer und amerikanischer Broker keine zusätzlichen Währungsumrechnungsgebühren und keine Verlustabschläge auf Nicht-Kernwährungen an, wodurch der Schutz der Kapitalrechte der Händler maximiert wird. Im Gegensatz dazu müssen Kunden von Hongkonger Brokern nicht nur Währungsumrechnungsgebühren tragen, sondern auch einen prozentualen Abschlag für andere Währungen als USD/HKD hinnehmen, was zu deutlich höheren tatsächlichen Transaktionskosten führt. Hinsichtlich der Kapitalflexibilität unterstützen europäische und amerikanische Broker die freie Allokation von Multiwährungsfonds und passen die Marginwährung an verschiedene Handelsstrategien an, was eine extrem hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Fondsnutzung ermöglicht. Hongkonger Broker hingegen verlangen die einheitliche Umrechnung von Fonds in USD oder HKD, was erhebliche Einschränkungen bei der Fondsallokation mit sich bringt und aufgrund von Währungsungleichgewichten leicht zu ungenutzten Mitteln führen kann. Bezüglich der Kundenreichweite können europäische und amerikanische Broker mit ihren Multiwährungs-Marginsystemen Kunden in verschiedenen Regionen weltweit erreichen und verfügen über einen deutlich diversifizierten und globalen Kundenstamm. Hongkonger Broker hingegen bedienen primär Kunden in Hongkong und USD-basierten Gebieten, was zu einer relativ begrenzten Kundenreichweite führt. Im Hinblick auf die Risikoabsicherungsmöglichkeiten können europäische und amerikanische Broker eine diversifizierte Absicherung von Multiwährungspositionen erreichen, was zu einer ausgewogeneren Gesamtrisikoverteilung führt. Hongkonger Broker stützen sich jedoch bei Absicherungsgeschäften auf eine einzige Währung, den US-Dollar, was zu einem relativ konzentrierten Risiko und erheblichen Defiziten hinsichtlich Flexibilität und Effizienz der Absicherung führt.
 13711580480@139.com
13711580480@139.com
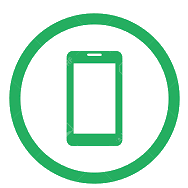 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 z.x.n@139.com
z.x.n@139.com
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou



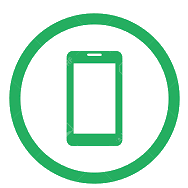 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou